0%
0%
EU-Regulierungspläne stoßen auf Ablehnung
Die EU-Kommission will eine Europäische Aufsichtsbehörde für die Märkte der elektronischen Kommunikation einrichten. Nur ein einheitlicher EU-Binnenmarkt für Telekommunikationdienstleistungen könnte flächendeckend für Angebotsvielfalt und niedrige Preise bei Mobilfunk und Breitband-Internetanschlüssen sorgen, warb die Kommission in einer Pressemitteilung für das "Telekom-Reformpaket". Die Branche, aber auch der Verband europäischer Regulierer (ERG), sind dagegen.
Die zuständige EU-Kommissarin Viviane Reding betonte, der Vorschlag rücke "den europäischen Bürger in den Mittelpunkt". Obwohl schon auf vielen nationalen Märkten neue Anbieter erfolgreich tätig sind, "dominieren die marktbeherrschenden Betreiber noch immer – häufig unter dem Schutz der eigenen Regierung – entscheidende Marktsegmente, vor allem den Breitbandmarkt". Die nationalen Regulierer stünden Regierung und Unternehmen teilweise "allzu nahe", um eine effektive Regulierung zu gewährleisten.
Die EU-Reform soll die Unabhängigkeit der nationalen Regulierungsbehörden stärken und gleichzeitig deren Zusammenarbeit untereinander und mit der EU-Kommission intensivieren. Dazu soll das neue Instrument der "funktionellen Trennung", aber auch die neue Behörde beitragen, welche die jetzigen Aufgaben der ERG und der Europäischen Agentur für Netz- und Informationssicherheit (ENISA) zusammenführen wird. Die ERG sieht darin einen Schritt zur Zentralisierung und damit zur Entmachtung der nationalen Regulierer. In einem offenen Brief an Reding verweist die Gruppe auf ihre erfolgreiche Arbeit der letzten Jahre, die keine neue Oberbehörde benötige und lädt die EU-Kommission zu einer engeren Zusammenarbeit ohne Dachorgan ein.
Die EU dagegen bemängelt, die Durchsetzung europäischer Richtlinien sei uneinheitlich und teilweise auch mangelhaft. Sie fürchtet auch Protektionismus in einzelnen Mitgliedsstaaten. Ihr größtes Anliegen ist eine bessere Regulierung des Breitbandmarktes, denn 10 % der EU-Bürger, davon die meisten in ländlichen Gebieten, haben noch immer keine Breitbandanbindung. Unter anderem in Deutschland sind Anbieter ohne eigenes Netz nach wie vor stark von den Bedingungen des etablierten Betreibers abhängig. Märkte mit "ausreichendem Wettbewerb" sollen dagegen dereguliert werden.
Diese Kombination hält der Verband der Anbieter von Telekommunikations- und Mehrwertdiensten (VATM) für widersinnig. Für ihn sei "völlig unverständlich, dass die EU gerade die Märkte aus der Regulierung entlassen will, die sie nach ihren eigenen, erst wenige Wochen alten Untersuchungen weiterhin für regulierungsbedürftig hält", bewertet VATM-Geschäftsführer Jürgen Grützner das Maßnahmenpaket. Er befürchtet "mehr Bürokratie, verringerte Effizienz, Kompetenzverlust der nationalen Regulierer sowie Arbeitsplatzverluste".
Neben der europäischen Regulierungsbehörde sind im "Telekom-Reformpaket" eine Stärkung der Verbraucherrechte, Maßnahmen für mehr Internetsicherheit und eine Neuordnung der Funkfrequenzen. So sollen Verbraucher künftig Anspruch darauf haben, den Telekomanbieter innerhalb eines Tages zu wechseln, transparente und vergleichbare Preisinformationen zu bekommen und kostenlose Rufnummern auch aus dem Ausland zu erreichen. Dazu soll es endlich den einheitlichen europäischen Notruf 112 geben.
Die Funkfrequenzen sollen für drahtlose Breitbanddienste in jenen Gebieten dienen, in denen die Verlegung neuer Glasfaserleitungen zu teuer ist. Der Übergang vom analogen zum digitalen Fernsehen wird eine beträchtliche Anzahl von Funkfrequenzen freimachen (die so genannte „digitale Dividende“), die für diesen Zweck verwendet werden können, so die EU-Kommission.
Das "Telekom-Paket" muss nun im Europäischen Parlament beraten und beschlossen und dann vom EU-Ministerrat gebilligt werden. Erst dann kann es – die EU-Kommission rechnet mit Ende 2009 - in Kraft treten.
Die zuständige EU-Kommissarin Viviane Reding betonte, der Vorschlag rücke "den europäischen Bürger in den Mittelpunkt". Obwohl schon auf vielen nationalen Märkten neue Anbieter erfolgreich tätig sind, "dominieren die marktbeherrschenden Betreiber noch immer – häufig unter dem Schutz der eigenen Regierung – entscheidende Marktsegmente, vor allem den Breitbandmarkt". Die nationalen Regulierer stünden Regierung und Unternehmen teilweise "allzu nahe", um eine effektive Regulierung zu gewährleisten.
Die EU-Reform soll die Unabhängigkeit der nationalen Regulierungsbehörden stärken und gleichzeitig deren Zusammenarbeit untereinander und mit der EU-Kommission intensivieren. Dazu soll das neue Instrument der "funktionellen Trennung", aber auch die neue Behörde beitragen, welche die jetzigen Aufgaben der ERG und der Europäischen Agentur für Netz- und Informationssicherheit (ENISA) zusammenführen wird. Die ERG sieht darin einen Schritt zur Zentralisierung und damit zur Entmachtung der nationalen Regulierer. In einem offenen Brief an Reding verweist die Gruppe auf ihre erfolgreiche Arbeit der letzten Jahre, die keine neue Oberbehörde benötige und lädt die EU-Kommission zu einer engeren Zusammenarbeit ohne Dachorgan ein.
Die EU dagegen bemängelt, die Durchsetzung europäischer Richtlinien sei uneinheitlich und teilweise auch mangelhaft. Sie fürchtet auch Protektionismus in einzelnen Mitgliedsstaaten. Ihr größtes Anliegen ist eine bessere Regulierung des Breitbandmarktes, denn 10 % der EU-Bürger, davon die meisten in ländlichen Gebieten, haben noch immer keine Breitbandanbindung. Unter anderem in Deutschland sind Anbieter ohne eigenes Netz nach wie vor stark von den Bedingungen des etablierten Betreibers abhängig. Märkte mit "ausreichendem Wettbewerb" sollen dagegen dereguliert werden.
Diese Kombination hält der Verband der Anbieter von Telekommunikations- und Mehrwertdiensten (VATM) für widersinnig. Für ihn sei "völlig unverständlich, dass die EU gerade die Märkte aus der Regulierung entlassen will, die sie nach ihren eigenen, erst wenige Wochen alten Untersuchungen weiterhin für regulierungsbedürftig hält", bewertet VATM-Geschäftsführer Jürgen Grützner das Maßnahmenpaket. Er befürchtet "mehr Bürokratie, verringerte Effizienz, Kompetenzverlust der nationalen Regulierer sowie Arbeitsplatzverluste".
Neben der europäischen Regulierungsbehörde sind im "Telekom-Reformpaket" eine Stärkung der Verbraucherrechte, Maßnahmen für mehr Internetsicherheit und eine Neuordnung der Funkfrequenzen. So sollen Verbraucher künftig Anspruch darauf haben, den Telekomanbieter innerhalb eines Tages zu wechseln, transparente und vergleichbare Preisinformationen zu bekommen und kostenlose Rufnummern auch aus dem Ausland zu erreichen. Dazu soll es endlich den einheitlichen europäischen Notruf 112 geben.
Die Funkfrequenzen sollen für drahtlose Breitbanddienste in jenen Gebieten dienen, in denen die Verlegung neuer Glasfaserleitungen zu teuer ist. Der Übergang vom analogen zum digitalen Fernsehen wird eine beträchtliche Anzahl von Funkfrequenzen freimachen (die so genannte „digitale Dividende“), die für diesen Zweck verwendet werden können, so die EU-Kommission.
Das "Telekom-Paket" muss nun im Europäischen Parlament beraten und beschlossen und dann vom EU-Ministerrat gebilligt werden. Erst dann kann es – die EU-Kommission rechnet mit Ende 2009 - in Kraft treten.



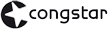

 Internet und Festnetz-Flat
Internet und Festnetz-Flat

 Die besten Handytarife
Die besten Handytarife
