Ratgeber: Vorratsdatenspeicherung
 Nach langem Ringen ist das neue Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung in Kraft getreten. Tariftipp.de erklärt, was sich durch die Vorratsdatenspeicherung für den Bürger ändert.
Nach langem Ringen ist das neue Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung in Kraft getreten. Tariftipp.de erklärt, was sich durch die Vorratsdatenspeicherung für den Bürger ändert.
Das neue Gesetz wurde bereits im Oktober 2015 im Bundestag verabschiedet. Anfang November zog dann der Bundesrat nach. Mit der jetzigen Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt ist das Gesetz nun rechtsgültig.
Ob dieser erneute Anlauf zur Vorratsdatenspeicherung Bestand haben wird, steht nicht. Datenschützer und Netzaktivisten haben bereits juristischen Einspruch angekündigt. Auch die Opposition im Bundestag, die aus Bündnis 90/Die Grünen und der Linkspartei besteht, geht gegen das neue Gesetz auf die Barrikaden.
Vorratsdatenspeicherung: Auswirkungen für den Bürger
Zehn Wochen lang wird im Rahmen der Vorratsdatenspeicherung gespeichert, wer wann mit wem wie lange telefoniert, SMS verschickt und im Internet surft. Vier Wochen lang werden die Standortdaten von Handy-Telefonaten aufbewahrt.
Daten zum E-Mail-Verkehr werden ebenso wie Kommunikationsinhalte bei der Vorratsdatenspeicherung nicht erfasst. Die Sicherheitsbehörden bekommen nur in bestimmten Fällen Zugriff auf die Daten. Doch die Erfassung von Daten trifft a priori nicht nur verdächtige Schwerverbrecher, sondern sämtliche und damit unbescholtene Bürger Deutschlands. Gerade dieser Aspekt wird von den Gegnern der Vorratsdatenspeicherung auch am meisten kritisiert.
Vorratsdatenspeicherung: Verwendung der Daten
Vorratsdatenspeicherung: Auswirkungen für die Wirtschaft
Auch die Wirtschaft und dabei namentlich die Telekommunikations-Unternehmen gehören zu den größten Kritikern der Vorratsdatenspeicherung, denn sie werden durch das neue Gesetz verpflichtet, Sicherheitsvorkehrungen einzuhalten, einen Server im Inland zu benutzen und die Daten nach Ablauf der vier oder zehn Wochen unverzüglich zu löschen. Sonst droht den Firmen ein Bußgeld.
Die betroffenen Unternehmen stören vor allem die Kosten, die durch die Vorratsdatenspeicherung auf sie zukommen. Der Verband der Internet-Wirtschaft namens eco schätzt die Kosten der Vorratsdatenspeicherung auf rund 600 Millionen Euro, die vom Staat nicht erstattet werden.
Vorratsdatenspeicherung: Was passiert mit sensiblen Daten?
Wie jedes Gesetz hat auch das Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung ein paar Ausnahmen. Diese betreffen vor allem sogenannte sensible Daten. So dürfen z.B. Anrufe bei Seelsorge-Hotlines grundsätzlich nicht erfasst. Auch die Daten von sogenannten Berufsgeheimnisträgern wie z.B. Rechtsanwälten, Ärzten, Abgeordneten oder Journalisten dürfen zwar gespeichert, aber nicht verwertet werden.
Allerdings ist es technisch nicht möglich, diese sensiblen Daten bei der Vorratsdatenspeicherung vorab herausfiltern. Insbesondere Journalisten-Verbände sehen daher den Informantenschutz in Gefahr.
Kann man die Vorratsdatenspeicherung umgehen?
Technisch gesehen ist die Umgehung der Vorratsdatenspeicherung durch sogenannte Krypto-Handys möglich. Solche abhörsicheren Mobiltelefone nutzen z.B. einige Mitglieder der Bundesregierung, aber auch gern Top-Manager von Unternehmen.
Eine weitere Möglichkeit, der Erfassung durch die Vorratsdatenspeicherung zu entgehen, ist die Nutzung von Prepaid-Karten, wenn diese keiner bestimmten Person zugeordnet werden können. Gleiches gilt für die Besucher von Internet-Cafés, wo eine Registrierung durch den Betreiber gesetzlich nicht vorgeschrieben ist.



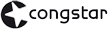


 Internet und Festnetz-Flat
Internet und Festnetz-Flat

 Die besten Handytarife
Die besten Handytarife
